|
Alle Artikel öffnen / schliessen Bleiben Sie sich und Ihrem Stil treu. Auch im Orthopädie-Bedarf. Wir helfen Ihnen die neuesten Trends einzufangen .... ist Marken-Wäsche von ausgesuchter und bewährter Qualität Unsere Experten lassen sich für eine ausführliche Beratung Zeit. Erstklassige Produkte überzeugen durch Qualität und Funktionalität. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ausgesuchten Ärzten und Therapeuten macht unsere Betreuung so einzigartig. In der Rehabilitationstechnik heben wir uns durch innovative und ausgezeichnete Produkte ab. Bei Buggys wird optimal auf die Bedürfnisse der kleinen Kundschaft eingegangen.
Gigantisch: Jahrhundertprojekt Drei-Schluchten-Damm
Für Deutschlandradio Der Drei-Schluchten-Damm in Zentralchina ist umstritten. Für Befürworter ist er "dringend notwendig", die Gegner äußern die Befürchtung, "er wäre für Mensch und Natur verheerend." Sicher ist nur eines: Der Staudamm am Jangtsee, dem längsten und wasserreichsten Fluss Chinas, ist ein Jahrhundertprojekt. Seit 1933 wird daran gebaut, und 2009 wird es abgeschlossen sein. Der gigantische Bau soll die Region in erster Linie mit Energie versorgen. Das dort ebenfalls entstehende Wasserkraftwerk wird, wenn alles planmäßig läuft, 2003 den ersten Strom ins Netz einspeisen. Für die Stromerzeugung wurden am Fuße des Damms 26 Generatoren mit einer Leistung von zusammen 18.200 Megawatt installiert, das entspricht der von fünfzehn Kernkraftwerken, bzw. 30 großen Kohlekraftwerken. Als Argument für den Dammbau nennen die Verantwortlichen weiterhin die langfristig verbesserte Verkehrsführung und eine genauere Flutbestimmung. Diese ist auch erforderlich. 1954 kamen bei der Wasserkatastrophe 30.000 Menschen ums Leben. 1996 konnte die Sieben-Millionen-Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, rund 600 Km westlich von Shanghai, nur durch den Einsatz tausender Helfer notdürftig vor den Fluten geschützt werden. Auch deutsche Unternehmen konkurrieren um Großaufträge für Turbinen und Generatoren. Ob nun Siemens, Liebherr oder ABB. Sie alle wollen am Projekt beteiligt sein. Doch Umweltschützer schlagen Alarm. Sie befürchten, dass das Mamut-Projekt die Tier- und Pflanzenwelt einer ganzen Region zerstören wird. Extreme Abholzungen verstärkten sogar noch die Überschwemmungen. 1,2 Mio. Menschen aus 153 Städten und 4.500 Dörfern müssen umgesiedelt werden. Die chinesische Regierung verweist auf großzügige Hilfen und moderne Häuser in den neuen Dörfern. Die Betroffenen sind aber skeptisch. Sie klagen: "Der finanzielle Ausgleich sei viel zu gering". Über die Kosten des Projekts gibt es unterschiedliche Angaben. Chinesische Stellen sprechen von 20 bis 35 Milliarden Dollar Gesamtkosten. Nach ausländischen Angaben betragen sie aber mindestens 75 Milliarden Dollar. © Marcus Douale
Wo Spielberg sich Musik besorgt: „Pedros-Schallplatten-Antiquariat“
Für Deutschlandradio Der hintere Teil der Wohnung des Schallplatten-Archivators und -Händlers Patzek sieht aus wie ein Museum: an den Wänden viele Ölbilder, unterschiedlichster Größen und Motive. Ein Mädchen mit hellblauem Kleid und blonden Haaren sticht besonders ins Auge. Mitten im Zimmer steht ein antiker heller Tisch, und ein nostalgisches Telefon aus längst vergangenen Tagen klingelt ab und zu mit schrillem Klang. Eine Waschmaschine läuft, und eine flauschige Katze und zwei kleine schwarze Mischlingshunde huschen durch den Raum. Im vorderen Teil der Wohnung befindet sich "Pedros-Schallplatten-Antiquariat". Das Geschäft, im Berliner Bezirk Charlottenburg, führt fast jede Schallplatte, die jemals gepresst wurde. 400.000 Titel weist der Lagerbestand an Langspielplatten und Singles auf. Im Unterschied zu Schallplatten-Second-Hand-Geschäften, die zusätzlich noch CDs anbieten, kann man bei dem 56-jährigen Peter Patzek nur Vinyl erwerben. O-Ton: "Ich sehe im Antiquariat nicht in erster Linie den Verkaufsladen, sondern ein Schallplatten-Antiquariat, das alles hat..." Schallplatten-Sammler sind besonders an Raritäten, Schellackplatten und ausgefallenen Scheiben interessiert. Die Preise liegen zwischen 5 und 1.000 DM. Mit Raritäten ist natürlich das meiste Geld zu verdienen. Aber auch das ist gar nicht so einfach, denn die Sammelgebiete und Kundenwünsche unterliegen Schwankungen und wechseln ständig. O-Ton: "Es gibt z.B. von den Stones einen Andruck... Irgendwas zwischen 500 und 1000 DM." Der ehemalige Ost-Berliner gründete "Pedros-Schallplatten-Antiquariat" mit seiner Frau 1967, nachdem er sich in den unterschiedlichsten Berufen und Branchen versucht hatte. Er arbeitete in Kneipen als DJ und war als Gelegenheitsarbeiter tätig. Sogar als Liedermacher wollte er sein Geld verdienen. Gab das aber schnell wieder auf. Der gerade Weg war nie seine Sache. O-Ton: "Das ganze fängt natürlich damit an, dass ich einer der sechzehn "Elvisse" der Schönhauser Allee war. So ist „Platten-Pedro“ entstanden." Auch entdeckte der Musikliebhaber und Fachmann, der gerne deutsche Versionen von internationalen Klassikern hört, eine "Marktlücke": Er bot etwas an, was es bislang noch nicht gab. Der Öffentlichkeit aber musste diese "Marktlücke" erst noch zugänglich gemacht werden, um sein Geschäft auch bekannt zu machen. O-Ton: "Der Text, zur Eröffnung, den ich an die Zeitungen geschrieben habe... Was ist das denn nun?" "Pedros-Schallplatten-Antiquariat" ist aber nicht nur in Berlin bekannt. Auch International hat sich bereits herumgesprochen, dass man vergriffene und seltene Schallplatten am ehesten in dem gemütlich-schmalen Geschäft findet. Regisseur Stevens Spielberg besorgte sich hier die Musik für seinen Film "Schindlers Liste", und der Schauspieler Manfred Krug stöbert bei "Pedro" am liebsten nach seinen runden Favoriten aus Vinyl. Platten-Archivar "Pedro" hat fünf Kinder: Einen Jungen, Oliver, und vier adoptierte Kinder: Ruben aus Equador, Anna aus Deutschland und Moritz-Herbert und Lilly aus Korea. O-Ton: "Die Arbeit und das Leben... Ist schon ziemlich gut..." Eine typische Kundenschicht gibt es nicht. Die Käufer sind unterschiedlich. Mal sucht jemand eine bestimmte Schallplatte, oder es möchte jemand nur Informationen oder Tipps bekommen. Es kommt aber auch vor, dass Kunden eine Melodie vorpfeifen und diese Platte dann haben möchten. Von 10 Uhr bis 18 Uhr haben Musikbegeisterte dann Gelegenheit zu stöbern oder sich Platten anzuhören. O-Ton: "'`Zig Platten hab' ich noch nie vorher gesehen, die ich hier finde... Fundgrube hier." Über das Käuferverhalten und den Musikgeschmack seiner Kunden spricht "Pedro" aus Erfahrung: Je leichter die Kost, je einprägsamer die Musik ist, desto größer sind die Chancen einen kommerziell erfolgreichen Hit zu landen. Im Gegenzug dazu hat es anspruchsvolle und schwierige Musik schwer... Dieses Phänomen sieht er gesellschaftlich begründet. O-Ton:" Die Überflussgesellschaft der 70er und 80er Jahre... Ist an Kunst nicht besonders interessiert..." Gibt es also nur gute und schlechte Musik? Glücklicherweise kann jeder letztlich selbst entscheiden, was er sich musikalisch zumuten möchte und was nicht... © Marcus Douale
Schwierige Zeiten: Beginn der 36. Bundeswehr-Kommandeurtagung
Für Deutschlandradio Alle zwei Jahre treffen sich auf der Kommandeurtagung der Bundeswehr etwa 450 ranghohe Millitärs zu einem Gedankenaustausch, und um über Verbesserungen innerhalb der Truppe nachzudenken. Dieses Jahr findet sie in Berlin, unter der Leitung von Generalinspekteur Hartmund Bagger statt. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesverteidigungsmininster Volker Rühe werden anwesend sein. Zentrales Thema der Tagung ist die Führung, Ausbildung und Erziehung in der Bundeswehr. "An Bewährtem festhalten - neue Aufgaben meistern" heißt das diesjährige Motto. Sorgte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1995 - wonach das Tucholsky-Zitat "Soldaten sind Mörder" nicht immer strafbar ist - noch für Empörung, beschäftigt die Bundeswehr heute andere Fragen. Die Kommandeurtagung wird sich mit den jüngsten Fällen von Rechtsextremismus in der Bundeswehr auseinandersetzen müssen. Die beiden aufgetauchten Skandalvideos, in denen nachgestellte Erschießungen, Vergewaltigungen und Hitler-Grüße zu sehen sind, lösten heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit aus. Es sollen aber auch positive Ereignisse der letzten Monate nach Außen gebracht werden. Pausenlos und tagelang kämpften Bundeswehr-Soldaten im Oderbruch letzten Sommer mit Sandsäcken gegen das Hochwasser. Das brachte der Truppe viel Dankbarkeit und Sympathie ein. Auch Außenpolitisch gibt es positive Signale: Volker Rühe hat gerade eine Patenschaft zwischen den Landstreitkräften Deutschlands, Dänemarks und Polens beschlossen. Das neue Korps soll im polnischen Stettin aufgestellt und im Frühjahr 1999 mit seiner Arbeit beginnen. Nach der Aufnahme Polens in die Nato. Durch Verteidigungsaufträge, wie die internationalen Einsätze in Bosnien, haben sich nach Auffassung Rühes "die Aussichten für eine friedliche Entwicklung verbessert." Die Bundeswehr verstehe sich nicht nur als Armee, die in Katastrophenfällen national eingesetzt wird. Vielmehr "sorge die Bundeswehr mit für Stabilität in Europa. Wenn in Zukunft 50.000 Soldaten aller Teilstreitkräfte für Aufgaben außerhalb der Nato eingesetzt werden können, sei das eine gewaltige, zusätzliche Leistung." © Marcus Douale
Ausweise am laufenden Band: die Bundesdruckerei in Berlin
Für Deutschlandradio Die Bundesdruckerei in Berlin kann mit einem neuen, digitalen Fertigungsverfahren ihre Produktionszeiten für Personalausweise und Reisepässe wesentlich beschleunigen. Dazu sagt Anja Oberhard, Pressesprecherin der Bundesdruckerei: 0-Ton: "Für den Personalausweis brauchen wir acht, für den Reisepass elf Arbeitstage..." Das ist möglich geworden, weil alle personenbezogenen Daten aus dem Antragsformular einschließlich Foto und Unterschrift von Laser-Ablesegeräten, sogenannten Scannern, erkannt und digital bearbeitet werden können. Mitarbeiter der Bundesdruckerei legen die Antragsformulare in eine spezielle Vorrichtung auf ein Fließband. Dieses transportiert die Vordrucke dann zu den drei Meter langen und einem Meter fünfzig großen Scannern. Dort werden sie per Laserstrahl gelesen und erkannt. Die Bundesdruckerei investierte 54 Millionen Mark in die neue Fertigungsanlage. 0-Ton: "35.000 - 50.000 Anträge können am gleichen Tag erfasst werden..." 1987 produzierte das Monopolunternehmen 5,4 Millionen Personalausweise. Für 1998 zeichnet sich eine deutliche Steigerung ab. Dabei wurde auch in die Sicherheit investiert. 0-Ton: "Ein großer Vorteil..." Die Bundesdruckerei produziert aber nicht nur Personalausweise, Reisepässe und Banknoten, sondern außerdem noch Briefmarken, Wertpapiere, Postsparbücher, Führerscheine, Euroschecks und Kraftfahrzeugbriefe- und scheine. 0-Ton: "Das Produktspektrum ist weit gefächert..." Dieses schnellere Produktionsverfahren soll sich natürlich auch für den Bürger auszahlen. Wenn die Bundesdruckerei diese Unterlagen rascher an die Ämter ausliefert, könnten sie schneller bearbeitet werden. Zwei bis vier Wochen brauchen die Einwohnermeldeämter im Durchschnitt für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen. In Urlaubszeiten, wenn viele Bürger neue Dokumente beantragen, kann sich diese Zeit noch verlängern. Wartezeiten, das ist wohl die schlechte Nachricht, sind auch weiterhin nicht ausgeschlossen. © Marcus Douale
Russland mitten in Berlin: das Café Hegel
Für Deutschlandradio 0-Ton: " Für mich ist dieses Café insofern besonders..." Das Café Hegel am Savignyplatz im Bezirk Charlottenburg hat viele Freunde. Für Kenner ist es eine feste Institution im Berliner Nachtleben. Es ist gleichermaßen ein Treffpunkt für Intelektuelle, wie für Liebhaber russischer Kultur. Russische Cafés und Restaurants haben in Berlin Tradition. Anfang der 20er Jahre gab es an der Spree-Metropole über 300.000 Emigranten. Künstler wie der Schriftsteller Wladimir Nabokov, der Regisseur Sergeij Eisenstein und der Maler Vasily Kandinsky waren darunter. Musik ist ein fester Bestandteil der russischen Lebensart. Sie spiegelt die russische Seele wohl am eindringlichsten wider. Deshalb soll Boris, der Pianospieler, für eine angemessene Stimmung aus "Mütterchen Russland" sorgen. 0-Ton: "Ich spiele hier jeden Abend, außer Mittwoch. Kommen Sie bitte..." Musik. Boris stammt aus Moskau, wo er auch zum Musiklehrer ausgebildet wurde. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hat er in Berlin eine neue Heimat gefunden. Auch andere Kaffeehauskünstler trifft man im Café Hegel. Aleksandr Kopanev ist einer von ihnen. Er singt nicht nur dort, er komponiert auch und hat sich bereits mit Folklore über die Grenzen Berlins schon einen Namen gemacht. Der St. Petersburger ist an vielen Projekten beteiligt, und noch einige schweben ihm im Kopf herum. 0-Ton: "Theater, Theater, Theater, Musical..." Lucinka Wichmann, die Inhaberin und Wirtin des Cafés, kommt aus Kiew, Berlin aber ist ihr längst zur Heimat geworden. 0-Ton: "Nach Berlin bin ich 1951 gekommen. Ein Traum, ein eigenes Café zu haben..." Die lebenslustige, agile rothaarige Wirtin ist eine Persönlichkeit, die sich für ihre russischen Landsleute einsetzt und ihnen, soweit es in ihren Möglichkeiten liegt, auch hilft. 0-Ton: "Bei mir verkehren vorwiegend russische Künstler. Mutter für russische Musiker..." Natürlich bietet sie ihren Gästen auch kulinarische Leckerbissen an. Der interessierte Gast kann sich mit russischen Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Schließlich kocht hier die Chefin selbst. 0-Ton: "Um nicht nur den Geist, sondern auch den Leib aufzuwärmen, vertragen würde..." Der persönliche Kontakt zu ihren Gästen ist Lucinka wichtig, und er ist auch notwendig für sie. 0-Ton: "Wenn ich am Tresen stehe und meine Gäste... Macht mich jeden Tag aufs Neue glücklich..." Das beliebte Café bringt deutschen Besuchern die russische Kultur näher. Und russische Landsleute können im Gegenzug mit deutschen ins Gespräch kommen und Gedanken austauschen. Wo kann das besser funktionieren, als zu später Stunde am Tresen? © Marcus Douale FERNSEHTEXTE
Verneigung vor dem Meister: Christian Dior Retrospektive in New York
Für n-tv Zweifellos gehörte er zu den wichtigsten und bedeutendsten Modedesignern, die es je gab: der Franzose Christian Dior. Ihm widmet das New Yorker Metropolitan Museum of Art eine Retrospektive, die noch bis zum ... zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung des innovativen Modeschöpfers. Erste Kostüm-Entwürfe sind genauso zu sehen, wie 80 weitere Creationen aus seinen Anfangsjahren. Dior, der 1947 seine erste Haute-Couture-Collection mit körperbetonten Oberteilen und schwingenden Röcken vorstellte, kreierte damit einen neuen Look. Sein eigener, unverkennbarer Stil sorgte für Aufsehen und machte ihn zum ersten, auch international bekannten Designer. Christian Dior starb 1957 an einem Herzinfakt. © Marcus Douale
Von Irkutsk zur Laptewsee: Expedition Trans-Sibirien
Für die ARD Riesiges Sibirien. Geheimnisvoll. Unerschlossen. Fremdartig. Viele Geschichten erzählt man sich über das Land hinter dem Ural. Die Wälder der Taiga sind gigantisch und nahezu unberührt. Eine Gruppe junger Franzosen hat sich auf den Weg gemacht, dieses Land nur mit traditionellen Fortbewegungsmitteln zu durchqueren. Die Expedition hat sich Unglaubliches vorgenommen: Knapp 8.000 Km sind zurückzulegen. Völlig auf sich allein gestellt, müssen sie sich von der Natur versorgen, wenn sie überleben wollen. In Irkutsk soll die Expedition beginnen und am Polarmeer enden. Die Anforderungen für Mensch und Tier sind enorm. Es gilt Wetterverhältnissen zu trotzen und sich immer wieder zu überwinden. Ob nun zu Wasser - auf dem riesigen, scheinbar nicht enden wollenden Baikalsee, dem größten Süßwasserbecken der Erde - oder zu Lande, unterwegs mit Schlittenhunden, die hier nach der ersten Etappe, auf den Winter vorbereitet werden. Immer wieder geht es um die Auseinandersetzung mit der Natur und die Überwindung der eigenen Grenzen. Die Naturgewalten werden sichtbar und fühlbar. Nach den Wochen der Vorbereitung auf den Winter, zieht die Expedition mit Hundegespannen weiter... Um unter diesen Bedingungen überleben zu können, müssen die Männer von der Natur nehmen und sich ihr anpassen, auch wenn vieles grausam und hart erscheint. Für die Hunde ist dieses erfrorene Rentier eine willkommene Abwechslung im Speiseplan. Die Expedition nutzt die einzige Chance in diesem Gelände mit Schlittenhunden vorwärts zu kommen, und bewegt sich auf den zugefrorenen Flüssen... Nicht nur das harte Klima, sondern auch die Monotonie des endlosen Landes macht Mensch und Tier zu schaffen. Die Hundegespanne werden, nachdem sie hunderte von Kilometern zurückgelegt haben, durch Ponys ersetzt. Endlich ein Hauch von Zivilisation: Die Männer treffen auf ein abgelegenes Dorf. Unwirklich und gespenstisch wirkt diese kleine menschliche Siedlung mitten in der Wildnis, aber sie bietet kurzfristig Schutz und die Möglichkeit die Tiere zu versorgen. Die Einheimischen empfangen die Franzosen herzlich. Zwei Kulturen treffen aufeinander. Aber Kommunikation kommt zustande. Mehr als ein paar Häuser gibt es hier nicht. Nach kurzer Rast, ziehen die Männer ungewissen Weiten, neuen Strapazen, aber auch neuen Erfahrungen entgegen... Die Völker Sibiriens verwenden schon seit Jahrhunderten Rentiere als Transport- und Nahrungsmittel. Für die Franzosen aber stellt diese Art der Fortbewegung eine neue Herausforderung dar. Der meterhohe Schnee macht den Tieren und dem Menschen schwer zu schaffen... Auch mit größter Anstrengung legt man nur wenig Strecke zurück. Die Mitglieder der Expedition wissen, dass sie um jeden Preis, ganz gleich wie groß die Strapazen und Einbußen auch sein mögen, das selbst gesteckte Ziel erreichen müssen. Denn hier, mitten im sibirischen Winter, sind weder Einhalt noch Umkehr möglich. In diesem fernen Winkel der Welt, auch unter extremen Umständen, genießen es die Menschen sich aus dem harten Alltag wegträumen zu können. Die Musiker wurden eigens mit dem Hubschrauber eingeflogen und verabschieden sich, nach einem kleinen Zwischenspiel, um die Sibirien-Tournee fortzusetzen. Für die Expedition geht es weiter. Noch ist das Ziel, das Polarmeer, nur ein hoffnungsvoller Traum... Manchmal wünschen sich die Männer einfach wie diese Musiker nach Hause fliegen zu können. Aber die Mannschaft hat sich fest vorgenommen, die Expedition ans Ziel zu bringen. Komme was wolle... Erschöpft und ausgelaugt ziehen die Männer weiter durch die endlosen Landschaften aus Eis und Schnee. Sie wissen, dass sie sich nur auf ihre Ausrüstung, die Tiere und auf sich selbst verlassen können. Aber wird das ausreichen, um die Expedition erfolgreich abschließen zu können? © Marcus Douale
131 Meter ohne Atemgerät: Weltrekord im Apnoe-Tauchen
Für n-tv Taucher treffen letzte Vorkehrungen. Zuschauer warten angespannt. Wenige Km vor Sardinien will Umberto Pelizzari beweisen, dass für ihn die Grenzen im Apnoe-Tauchen noch lange nicht erreicht sind. Konzentriert umklammert er den sogenannten "Schlitten", einen 54 Kg schweren Anker, der ihn jeden Moment in die Tiefe reißen wird. Noch zwanzig Sekunden: Umberto Pelizzari scheint in sich versunken. In seinen Gedanken rauscht er bereits durch die Fluten, kämpft mit dem Druck in mehr als 120 Metern Tiefe. Noch drei Sekunden: Ein letztes Mal pumpt Pelizzari seine Lungen voll. Dann das Signal: go. Auf den ersten Metern bereitet ihm der Druckausgleich wenig Probleme. Dann nimmt er aber ständig zu. Alle zehn Meter um ein bar. In 50 Metern Tiefe wird es um ihn herum ruhiger. Pelizzari hält seine Augen geschlossen und versucht sich zu entspannen. Kurz vor seinem Ziel, 128 Meter unter dem Meeresspiegel, hat der Druck fast dreizehn bar erreicht. Für die meisten Menschen ist es kaum vorstellbar, wie schwierig es ist, in dieser Tiefe überhaupt noch einen Ausgleich herzustellen. Denn selbst sein Lungenvolumen von acht Litern reicht unter diesem Druck kaum noch aus, den Druck in den Hohlräumen des Kopfes zu egalisieren. 131 Meter: Pelizzari erreicht das Ziel. Mit einem luftgefüllten Ballon ist das Auftauchen dann kein Problem mehr. Auf den letzten Metern nach oben, steigt in ihm ein unvorstellbares Glücksgefühl auf. Er hat es wirklich geschafft. Zehn Monate hartes Training waren notwendig. Aber es hat sich gelohnt. Nach drei Minuten und 32 Sekunden ist die Strapaze vorbei. Wer allerdings glaubt, der Extremtaucher sei an seine körperlichen und geistigen Grenzen gelangt, der irrt: Der Italiener kann bis zu acht Minuten ohne Luft unter Wasser bleiben. Dem Weltrekordversuch von 150 Metern steht somit nichts mehr im Wege... © Marcus Douale
Kick in 12.000 Metern Höhe: Weltrekord im Free-Falling
Für n-tv Ein Flugplatz in der Nähe von Moskau: Das russische Transportflugzeug Iljuschin 76 bringt Patrick de Gayardon auf 12.700 Meter. Aus dieser Höhe will er abspringen. Ohne Atemgerät. Noch nie hat ein Mensch einen Sprung unter diesen Bedingungen gewagt. Name des sportlichen Wahnsinns: Free-Falling. In 12.000 Metern Höhe herrschen eisige Temperaturen von -55 Grad. Patrick de Gayardon muss einen Schutzanzug tragen. Eine Spezialanfertigung. Der Overall ist mit fünf Kunststoffschichten überzogen, und kann außerdem die Feuchtigkeit des Körpers aufnehmen und nach Außen abgeben. Zeit für den Absprung. Dann ist es soweit. 40 lange Sekunden kann der 35-Jährige wegen der dünnen Luft nicht atmen. Erst wieder, wenn die 8.000-Meter-Grenze erreicht ist. Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit. Eine andere Welt eröffnet sich ihm. Mit Tempo 360 - das sind 100 Meter pro Sekunde, oder anders gesagt, mit Formel-1-Geschwindigkeit - schießt er auf die Erde zu. Mehr als 5 Km freier Fall. Dann noch 3.000 Meter am Fallschirm, und er hat wieder festen Boden unter den Füßen. Knapp acht Minuten dauerte der Nervenkitzel. Das Unglaubliche ist geschafft. Glücklich feiert Patrick de Gayardon mit seinem Team den Weltrekord. Lange wird die Bestmarke aber keinen Bestand haben, denn Patrick de Gayardon will noch höher hinaus... © Marcus Douale
Nur mit Schlitten und Ski durch die Antarktis: Borge Ousland
Für n-tv Start der Südpol-Expedition des Norwegers Borge Ousland. Der Abenteurer hat sich vorgenommen, alleine 2.700 Km durch die Antarktis - nur mit Ski und Schlitten - zurückzulegen. Die Route führt ihn von der Berknerinsel im Weddelmeer, über den Südpol, zum Stützpunkt McMurdo im Rossmeer. Es ist die Herausforderung, die ihn reizt und antreibt, sich immer wieder aufs Neue gegen die Naturgewalten beweisen zu müssen. Ousland hat bereits Erfahrung mit Expeditionen. Seine Erste, 1994, führte ihn zum Nordpol. Nach wenigen Tagen nimmt der Wind zu. So stark, dass Ousland zum schnelleren Vorwärtskommen ein Segel setzen und sein Tagespensum auf 40 Km erhöhen kann. Auch die äußeren Umstände sind gut: Im ewigen Eis herrschen zum Jahresende Temperaturen von -4 bis -40 Grad. Doch die geringe Luftfeuchtigkeit macht das Atmen schwer. Die 10-stündigen Fußmärsche werden zur Strapaze. Plötzlich auftretende Schneestürme und verschneite Gletscherspalten zur ständigen Gefahr. Die Einsamkeit und die Angst vor Schneeblindheit sind immer da... Der 33-Jährige hat nur das Nötigste mitgenommen: Zelt, Schlafsack, getrocknete Lebensmittel, ein Ortungsgerät für Notfälle und natürlich Karte und Kompass. Jede Abweichung von der Route würde unweigerlich die Tortur verlängern. Der Südpol liegt 75 Km hinter ihm. 44 Tage ist Ousland jetzt schon unterwegs, sein Ziel aber noch mal so weit entfernt. Ousland wird dort nicht ankommen. Er kann kaum noch laufen. Durch Kälte, Feuchtigkeit und Reibung sind seine Oberschenkel entzündet. Abszesse haben sich gebildet. Das Aus für seine Expedition. Doch das Wagnis Antarktis bleibt für Borge Ousland eine persönliche Herausforderung: Nur wenige Monate später hat er sich erneut der Eiswüste gestellt. Und diesmal will er es schaffen... © Marcus Douale
Was kostet die Urzeit? Fossilien- und Meteoriten-Versteigerung in New York
Für n-tv Ungewöhnliche Versteigerung in New York: Fossilien und Meteoriten sind im Auktionshaus Philipps unter den Hammer gekommen. Die Stars unter den Objekten, die meistbietend an den Käufer gebracht werden sollten, waren Dinosaurier-Eier. Sie wurden vor 75 Millionen Jahren irgendwo im Nordosten Asiens von einem Therizinosaurier gelegt und sind erstaunlich gut erhalten. 800.000 Dollar wollte ihr Besitzer Terry W. Manning für sie haben. Doch niemandem waren die Funde aus der Urzeit so viel wert. Das Interesse der Käufer hielt sich in Grenzen. Lediglich 32.500 Dollar pro Ei wurden geboten. Zu wenig. Denn laut Manning kostete allein die Bergung 72.000 Dollar. Er ist zwar enttäuscht über so viel Desinteresse, will aber nicht aufgeben. Auch Meteoriten-Reste konnten erstanden werden. Es war die größte Auktion für Weltraumgestein, die bisher stattgefunden hat. Ein Exemplar stammt vom Mars und ist drei Millionen Jahre alt. Gefunden wurde es in der Katsina Provinz in Nigeria. Einen Käufer fand es ebenfalls nicht. © Marcus Douale
Die Crème de la Crème trifft sich: zweites Ballet-Festival in St. Petersburg
Für n-tv St. Petersburg ist zur Zeit Treffpunkt zahlreicher Primaballerinen. Hier findet im prunkvollen Maryinski Theater das zweite Festival dieser Art statt. Selbst der Eiserne Vorhang konnte den weltweiten Siegeszug des ehemals sowjetischen Ballets nicht aufhalten. Es hat Tradition, und zählt zu den besten der Welt. Von den elf verliehenen Preisen, die die Preisrichter vergaben, gingen allein neun an russische Tänzerinnen und Tänzer. Der Wettbewerb ist nach der Primaballerina Maya Plisetskaya benannt. Sie zählt zu den größten Tänzerinnen aller Zeiten. In Russland geboren, wurde sie 1943 Mitglied des Bolshoi Theaters und tanzte in fünfzig Jahren Showgeschäft nahezu alle bekannten Balletstücke. Ob "Schwanensee", "Der Nussknacker" oder "Romeo und Julia". Die Russin war immer dabei. Heute, mit 71, ist sie noch immer in vielen Charakterrollen zu sehen. © Marcus Douale PRINTTEXTE
„∏“ Filmkritik
Für den Tagesspiegel 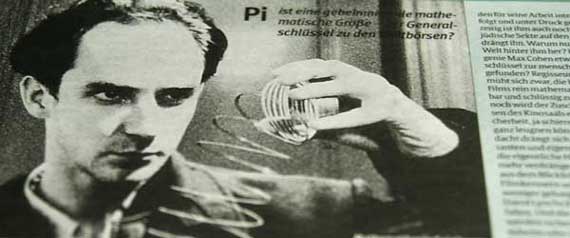 Was kommt wohl dabei heraus wenn ein Harvard-Absolvent einen Film dreht? Wird es ein informatives, ein belehrendes oder gar ein anmaßendes Werk sein? Der 28-jährige Amerikaner Darren Aronowsky hat die berühmte Elite-Uni besucht und außerdem noch das renommierte American Film Institute. Was er dort alles gelernt hat, können wir jetzt auf der Leinwand bewundern. Sein filmischer Erstling lässt sich – zumindest dem Titel nach – mit nur einem Zeichen darstellen: „∏“. So verwirrend und irritierend der Filmtitel, so unkonventionell und kompliziert ist auch die Story seines Streifens in Schwarzweiß. „∏“ ist ein Science-Fiction-Thriller, verworren, geheimnisvoll, rätselhaft und auch ein bisschen depressiv, der mit den modernen, visuellen und akkustischen Mitteln arbeitet, die wir nur zu gut von der rotierenden Konsumindustrie her kennen. Eben jener flotten MTV-Ästhetik, an der heute niemand mehr vorbeikommt. Für den mathematikbessenen Computerfreak Max Cohen (Sean Gullette) besteht das Leben aus einer einzigen Aneinanderreihung von Zahlenreihen und –systemen. Während seiner numerischen Forschungen wird er von einer Firma, die sich aus finanziellen Gründen für seine Arbeit interessiert, verfolgt und unter Druck gesetzt. Gleichzeitig ist ihm auch noch eine fanatische jüdische Sekte auf den Fersen und bedrängt ihn. Warum nur ist plötzlich alle Welt hinter ihm her? Hat das Mathegenie Max Cohen etwa den Generalschlüssel zur menschlichen Existenz gefunden? Regisseur Aronowsky bemüht sich zwar die Handlung seines Films rein mathematisch nachvollziehbar und schlüssig zu machen, aber dennoch wird der Zuschauer beim Verlassen des Kinosaals eine gewisse Unsicherheit, ja schiere Ratlosigkeit nicht ganz leugnen können. Denn der Verdacht drängt sich auf, dass die interessanten und eigenwilligen Bilder von „p“ die eigentliche Handlung mehr und mehr verdrängen, und am Ende gar völlig aus dem Blickwinkel verschwinden lassen. Filmkennern wird dazu die (mehr oder weniger gelungene) Anlehnung an David Lynchs Erstling „Eraserhead“ auffallen. Und die „Handlungsfixierten“ werden sicher noch Stunden später - daheim oder in der Kneipe - über den Inhalt von „p“ diskutieren. Schließlich, beim Nachhausegehen, erinnern sie sich dann wieder daran, dass es Filme gibt, die man verstehen kann und andere, die trotz größter Grübelei einfach nicht zu knacken sind. Auch nicht von verwirrten Matheprofis. Diese Sorte Film kennen wir gut. Spätestens seit „Lost Highway“. „∏“ USA 1998 Buch und Regie: Darren Aronowsky Darsteller: Sean Gullette, Mark Margolis... © Marcus Douale
Die neun Pforten Filmkritik
Für den Tagesspiegel  In seinem fünfzehnten Film „Die neun Pforten“ wagt sich Roman Polanski an Mystisches und Geheimnisvolles heran. Mit Dämonen, dem Teufel und sogar einem Engel hat sich der Protagonist herumzuschlagen. Natürlich ist die Erwartungshaltung und das Interesse bei einem Regisseur wie ihm – das darf und kann man auch erwarten – enorm. Viele Meisterwerke hat der gebürtige Pole schon auf die Leinwand gezaubert. Dabei ist er stets, wie alle anderen großen Regisseure, von Genre zu Genre gependelt. Seinen hohen Anspruch aber, Kreativität und Anspruch auch in den unterschiedlichsten Filmen zu beweisen, konnte er immer erfülllen. Egal ob es sich nun um einen Klassiker wie „Macbeth“ (1971) handelt, eine Hommage an den Dedektivfilm wie „Chinatown“ (1974) oder um Politisches wie „Der Tod und das Mädchen“ (1994). Polanskis Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit scheint grenzenlos und unerschöpflich zu sein. Es gibt wohl kein Thema, das ihn nicht interessiert. Und kein Stoff, der ihm zu schwierig ist. Deshalb müssen wir wohl nun, nach fünf Jahren der Abstinenz, „Die neun Pforten“ auch zu schätzen wissen. Wie eine hervorragende Flasche Wein. Edle Trüffel. Oder eine Dose kostbaren Kaviars. Denn auch dieses Werk trägt die bewährte Handschrift des Meisters: eine ausgeklügelte Inszenierung, ausgefeilte Spannungsbögen und rätselhafte und geheimnisvolle Bilder. Aber obwohl Johnny Depp als junge Bücherjäger schauspielerisch zur Höchstform aufläuft und sich auch seine anderen Mimenkollegen brillant präsentieren, entlässt einen der Film doch unbefriedigt und mit deutlich gemischten Gefühlen. Vielleicht ist es der Eindruck, dass auch einem der Großen des Kinos irgendwann mal die Puste ausgeht? Oder das man das alles doch so oder so ähnlich schon tausendmal vorher irgendwo gesehen hat. Die Story: Ein leidenschaftlicher Sammler von Dämonen-Literatur beauftragt den Bücherhändler Dean Corso, die beiden letzten Exemplare eines geheimnisvollen Buches zu finden. Auf seiner Suche danach tun sich für den Bücherjäger Abgründe auf, und er taucht hinab ins Reich der Finsternis... Bleibt festzuhalten: „Die neun Pforten“ ist spannend, fesselnd und visuell gut gemacht. Aber für einen Polanski-Film eben doch nicht ganz überzeugend. Und vielleicht sogar auch ein bisschen enttäuschend. Die neun Pforten Frankreich/Spanien 1999 Regie: Roman Polanski Darsteller: Johnny Depp, Emmanuelle Seigner... © Marcus Douale
Rush Hour Filmkritik
Für den Tagesspiegel  Der Name Jackie Chan steht für eine ganz eigene, nicht kopierbare Mischung aus asiatischer Kampfkunst und frechem Humor. Seine Filme unterscheiden sich deutlich von billig-dumpfer Hong-Kong-Massenware. Jetzt legt Meister Chan sein neuestes Werk vor. Und wie immer können sich Freunde des Genres wieder voll und ganz auf den Mann aus China verlassen. Perfekte Prügel-Choreographien, atemberaubende Stunts und Action en gros gibt es wieder zuhauf. Natürlich ist der smarte Jackie wieder der Gute, und natürlich muss er sich auch wieder mit harten und üblen Jungs herumschlagen. Doch gerade die ihm auf den Leib geschriebene Perfektion der Kampfszenen und die „Verwissenschaftlichung“ der Action machen den Film auch für Kinogänger sehenswert, die mit dem Namen Jackie Chan bisher noch nichts anfangen konnten. Obwohl man natürlich darüber streiten kann, ob „Rush Hour“ letztendlich als genialer Trash oder einfach nur als primitiv zu bezeichnen ist. Im Gegensatz zu amerikanischen Actionfilmen jedenfalls, zeichnet sich der kleine Asiat dadurch aus, dass er auch über sich selbst lachen kann. Zur Handlung: als die 11-jährige Tochter des chinesischen Botschafters entführt wird, schaltet sich routinemäßig das FBI ein. Das reicht dem Diplomaten aber nicht aus. Deshalb heuert er Inspektor Lee (Jackie Chan) von der Royal Hong Kong Police an, der mit dem tolpatchig-chaotischen LAPD-Polizisten Carter (James Tucker) den Fall aufklären soll. Nach unzähligen körperlichen Auseinandersetzungen, gigantischen Explosionen, lebensgefährlichen Verfolgungsjagten und unzähligen Schießereien kommen sie den Tätern schließlich näher und fühlen ihnen auf den Zahn. Für Action- und Karatefreunde ist „Rush Hour“ ein unbedingtes Muss. Für alle anderen ein anderthalbstündiges Unterhaltungsspektakel. Rush Hour USA 1997 Regie: Brett Ratner Darsteller: Jackie Chan, Chris Tucker... © Marcus Douale
Stuart Little Filmkritik
Für den Tagesspiegel 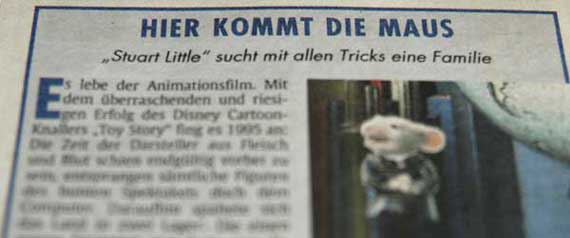 Es lebe der Animationsfilm. Mit dem überraschenden und riesigen Erfolg des Disney-Cartoon-Knallers „Toy Story“ fing es 1995 an: Die Zeit der Darsteller aus Fleisch und Blut schien endgültig vorbei zu sein, entsprangen sämtliche Figuren des bunten Spektakels doch dem Computer. Daraufhin spaltete sich das Land in zwei Lager: die einen waren fasziniert von dem, was die Technik heute alles möglich werden lässt. Die anderen belächelten gerade deswegen den Streifen. Rob Minkoffs „Stuart Little“ ist ebenfalls ein Animationsfilm. Mit einer niedlichen Maus als Protagonisten, einem menschlichen Star (Gina Davis) und am Rechner gemachten Tricks, die wirklich beeindrucken. Familie Little möchte ein Kind adoptieren, doch das ist gar nicht so einfach. Denn wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Schließlich entscheidet sie sich für die freche und kecke Maus Stuart. Schon wenig später bringt der kleine Nager die heile Welt der Zweibeiner gehörig durcheinander und muss außerdem zahlreiche Gefahren überwinden. Obwohl die Story recht einfach gehalten ist, rührt die charmante Umsetzung. Und mal abgesehen von der übertriebenen amerikanischen Familien-Heiligkeit und den manchmal doch sehr schnulzigen Dialogen ist „Stuart Little“ unbedingt sehenswert. Schließlich bietet die weiße Maus pfiffigen und originellen Spaß für die ganze Familie. Stuart Little USA 1999 Regie: Rob Minkoff Darsteller: Gina Davis, Hugh Laurie... © Marcus Douale
Schweinchen Babe in der großen Stadt Filmkritik
Für den Tagesspiegel 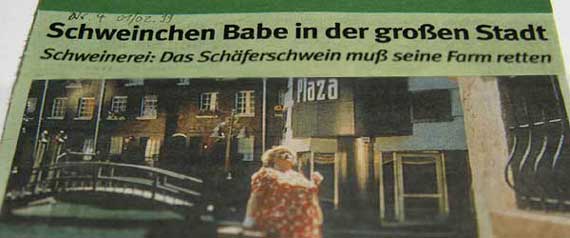 George Miller ist wirklich vielseitig. Er bescherte uns „Mad Max“ mit Mel Gibson und die rührselige Krankengeschichte „Lorenzos Öl“ mit Nick Nolte und Susan Sarandon in den Hauptrollen. Nun meldet er sich mit Tierischem zurück: „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ heißt sein Tier-Animations-Spielfilm, der natürlich wieder vom herzensguten Borstenvieh Babe handelt und ein ebenso großer Publikumserfolg wie sein Vorgänger werden soll. Die Zutaten stimmen jedenfalls: Tiere werden vermenschlicht, Kitsch und Rührseligkeit noch und nöcher. Diesmal muss das intelligente „Schäferschwein“ um die Farm seines Frauchens und Herrchens kämpfen. Denn der idyllisch gelegene Bauernhof, wo die Welt noch in Ordnung ist, wird massiv bedroht: Die Bank will Farmer Hogget und seiner Frau den schönen, von allerlei niedlichen (und vor allem sprechenden) Tieren bewohnten Hof wegnehmen. Deshalb begeben sich Frau Hogget und Babe in die Stadt, um dort nach einem Ausweg aus dem Desaster zu suchen. Zugegeben, „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ ist solide verfilmt, enthält nostalgisch-schöne Bilder und ein paar originelle Szenen. Und vielleicht ist so mancher Zuschauer so ergriffen, dass er sich mit dem Taschentuch die Tränen aus den Augen wischt. Doch davon mal abgesehen, ist der Film nur für Kinder und Freunde der Landwirtschaft von Interesse. Schweinchen Babe in der großen Stadt USA 1998 Regie: George Miller Darsteller: James Cromwell, Magda Szubansky... © Marcus Douale
Clip Cult Vol. 1 – Exploding Cinema Filmkritik
Für den Tagesspiegel  Dass Musikvideos fester Bestandteil unserer Unterhaltungs- und Konsumindustrie sind, dürfte wohl niemand mehr bestreiten. Garantieren die bunten Bilder mit relaxed tanzenden Models und zuckersüßen Milchbubies doch klingende Kassen. Und dabei ist es ganz egal, wie schwach und dünn der Song auch ist. Denn die visuellen Aspekte haben heute mindestens den gleichen Stellenwert wie die akkustischen. Sich über diese Tatsache zu ärgern oder sie verändern zu wollen, wäre so erfolgreich, wie Don Quichottes Kampf gegen die Windmühlen. Aber schließlich gibt es ja immer noch Ausnahmen. „Clip Cult Vol. 1 – Exploding Cinema“ ist so eine. Die hier versammelten Videos sind künstlerisch wie musikalisch derart gelungen, dass es sich unbedingt lohnt, die 12 Clips anzuschauen. Wo kommt man denn sonst noch in den Genuss, all die Helden der Elektro-Avantgarde auch filmisch zu bewundern? Und Abgefahrenes von Aphex Twin, Photek, Autechre und und und bestaunen zu können. Clip Cult Vol. 1 – Exploding Cinema Großbritannien/Frankreich/Japan/USA 1999 Video Clips © Marcus Douale
Verhandlungssache Filmkritik
Für den Tagesspiegel  Was Morgan Freeman an Würde und Stolz ausstrahlt, dass verkörpert Samuel L. Jackson an Kaltblütig- und Skrupellosigkeit. Denn einer muss schließlich immer der Gute sein und ein anderer immer der Schlechte. Ein altes Spiel. Da ist es also nur logisch, dass Regisseur Gary Gray, der vorher schon solide Kost wie „Stirb langsam“ drehte, dieses altbewährte Muster aufgreift und es auf seine Weise umsetzt. In „Verhandlungssache“ rettet niemand in Bruce-Willis-Manier die Welt, und es geht auch nicht um einen Haufen Irrer, die wieder mal die Öffentlichkeit und den Weltfrieden bedrohen. Vielmehr ist „Verhandlungssache“ ein Krimi-Thriller, der im Polizeimilieu angesiedelt ist, und raffiniert Psychologie und Action miteinander verbindet. Und erfreulicherweise des Rätsels Lösung bis zum Schluss offen lässt. Aber trotz großartiger schauspielerischer Leistungen kommen die Akteure zeitweise nicht drum herum gängige Klischees zu bedienen. Etwa, dass auch im härtesten Manne ein liebendes Herz schlägt. Oder dass Mut wohl die größte aller Eigenschaften ist. Aber abgesehen von diesen Feinheiten bietet „Verhandlungssache“ hochwertige Action, knisterne Spannung und gelungene Psycho-Duelle. Polizei-Verhandlungsspezialist Roman hat in Chicago bei Geiselnahmen genug zu tun. Als dann aber sein Kollege und Kumpel im Auto erschossen aufgefunden wird, steht er auf der Verdächtigenliste ganz oben. Zudem taucht in seiner Wohnung auch noch Beweismaterial für einen Korruptionsfall auf. Da sieht Roman nur noch eine Möglichkeit, die Schuldigen zu entlarven... Verhandlungssache USA 1998 Regie: Gary Gray Darsteller: Samuel L. Jackson, Kevin Spacey... © Marcus Douale
Les Misérables Filmkritik
Für den Tagesspiegel 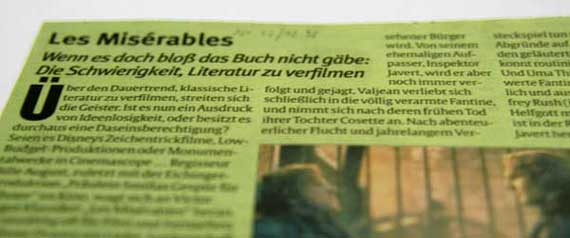 Über den Dauertrend, klassische Literatur zu verfilmen, streiten sich die Geister. Ist es nun ein Ausdruck von Ideenlosigkeit, oder besitzt es durchaus eine Daseinsberechtigung? Seien es Disneys-Zeichentrickfilme, Low-Budget-Produktionen oder Monumentalwerke in Cinemascope... Regisseur Bille August, zuletzt mit der Eichinger-Produktion „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ im Kino, wagt sich nun an Victor Hugos Klassiker „Les Misérables“ heran. Das unzählig oft für Film und Fernsehen verfilmte Drama um Liebe, Leidenschaft, Ungerechtigkeit und Revolution steht zudem auch als Musical auf den Spielplänen in Städten wie Duisburg und London... Erzählt wird die Geschichte des Jean Valjean, der seit 19 Jahren als Zwangsarbeiter dahinvegetiert, bis er durch die Güte eines Bischofs das Geschenk der Freiheit erhält und ein angesehener Bürger wird. Von seinem ehemaligen Aufpasser, Inspektor Javert, wird er aber noch immer verfolgt und gejagt. Valjean verliebt sich schließlich in die völlig verarmte Fantine, und nimmt sich nach deren frühen Tod ihrer Tochter Cosette an. Nach abenteuerlicher Flucht und jahrelangem Versteckspiel tun sich am Ende menschliche Abgründe auf. Liam Neeson verkörpert den geläuterten Verbrecher Valjean gekonnt routiniert und durchaus glaubhaft. Und Uma Thurman ist als bemitleidenswerte Fantine ungewohnt leidenschaftlich und ausdrucksstark. Aber nur Geoffrey Rush (in „Shine“ als Pianist David Helfgott mit dem Oscar ausgezeichnet) ist in der Rolle des besessenen Polizisten Javert herausragend. Bleibt festzustellen, dass es der hochkarätigen Besetzung gelingt, Hugos Klassiker zu tragen und ihm ein Gesicht zu verleihen. Zumal August ihn als großes Kino inszeniert hat. So kann „Les Misérables“ durchaus als gelungene Literaturverfilmung angesehen werden. Doch ein Meisterwerk der Weltliteratur bleibt eben immer nur als Buch ein Meisterwerk. Les Misérables Deutschland/Großbritannien 1998 Regie: Bille August Darsteller: Liam Neeson, Uma Thurman... © Marcus Douale ONLINETEXTE
Ein unvergessliches Erlebnis für gerade mal 10 Euro
Verwöhn doch mal Deine Sinne. Kreativ, fantasievoll und leidenschaftlich. Lass Dich fallen und fernöstlich verzaubern. Lerne die geheimnisvolle und faszinierende Welt der vietnamesischen Kochkunst kennen. Einzigartig. Erlesen und absolut besonders. Und auch noch gesund. Im … in ... Probiert es selbst aus. Die Rohstoffe der Speisen werden sofort frisch verarbeitet. Du findest im … aber noch mehr: Jede von Dir ausgesuchte vietnamesische Spezialität und dazu noch zwei aromatische Tees Deiner Wahl bei … jetzt für nur noch 10 Euro.
Aus 1 mach 2
Geh doch mal wieder ins Kino. Lass Dich für anderthalb Stunden in fremde Welten entführen. Erlebe Abenteuer im Mittelalter oder in der Gegenwart. Leide, liebe und fiebere mit. Lade Deine Freundin am Wochenende zum neuesten Hollywood-Blockbuster ein. Entspanne, lache und feiere mit einem Deiner Kumpels. Oder such Dir am Samstagabend einen Film aus, den Du selbst sehen willst. … bietet Dir …. an. Am Wochenende Deiner Wahl. Sei flexibel und spontan.
Regen, Regen, nichts als Regen
Für Sportgate Der Regen war wirklich unglaublich. Er war so stark, dass das Stadion fast nicht zu sehen war. Aber die Scheinwerfer gaben alles, um dem Dauerregen Paroli zu bieten. Und auch der Stadion-Parkplatz – eigentlich als "Power-Party-Spektakel“ vor dem Spiel geplant, sonst immer ein Tummelplatz für American-Football-Fans - war nahezu ausgestorben. Wegen des schlechten Wetters zog es die überwiegende Zahl der Fans früh zur Haupttribüne, die ja Überdacht ist. Der Kunstrasen wurde durch den Regen mehr und mehr aufgeweicht. Die Party zum Spiel fiel so - im wahrsten Sinne des Wortes - ins Wasser. Die Imbissbuden und sonstigen Entertainment-Möglichkeiten ließen sich aber nicht vertreiben. Sie hielten durch. Bis kurz vor dem Beginn des Spiels. Doch auch sie waren erleichtert, als sie schließlich - um 18:00 Uhr - ihre Zelte abbauen konnten. Dann wurde es langsam ernst. Der Spiel würde gleich beginnen. Die Fans wollten nun ihr Spiel sehen. Dabei war es schon egal, ob ihre Basecaps komplett durchnässt waren. Alles wartete gespannt im Jahn-Sportpark. Durch den Regen war der Rasen des Stadions nun völlig durchweicht. Und die blauen Logos der NFL-Europe an der 35-Yard-Linie waren mittlerweile von Schlamm überzogen. Von der Haupttribüne aus, waren sie fast gar nicht mehr zu erkennen. Die Cheerleader trotzten dem Wetter: Obwohl es nass und kalt war, waren die Mädchen tapfer. Sie gaben alles, um das Publikum zu unterhalten. Und sogar der Stadionsprecher legte sich ins Zeug. Denn ihm war natürlich auch klar, dass man hart im Nehmen sein musste, um dieses NFL-Europe-Spiel genießen zu können, und er dankte den Fans vor Spielbeginn für ihr Erscheinen.... © Marcus Douale
Endlich an Bedeutung gewonnen: Kraniosakrale Osteopathie
Für MEDICA.de Mit dem Stichwort Osteopathie können die meisten Menschen nichts anfangen. Doch gerade diese Behandlungsmethode der Physiotherapie wird nun endlich immer beliebter und von immer mehr Patienten bewusst nachgefragt und verlangt. Das Besondere der Osteopathie liegt im Verzicht auf jegliche Medikamente und in der nur auf physikalisch und therapeutisch reduzierten Behandlungsart. Kurz: der Sinn, das Wesen der Osteopathie besteht darin, das Leben und die Gesundheit des Patienten günstig zu beeinflussen. Körperliche Störungen, ob nun Kopfschmerz oder Tinnitus, Verspannungen oder Disharmonien, werden als Energiemedizin bekämpft und auf natürlichem Wege behandelt. Keinerlei Nebenwirkungen sind zu erwarten. Die Selbstheilungskraft wird angeregt, um die natürlichen Kräfte und Ressourcen zu aktivieren und zu stärken, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Die Grundlage der Osteopathie ist also nicht primär die Anwendung und Vermittlung von bestimmten Techniken, sondern die Einsicht und das Begreifen von bestimmten Prinzipien, die es dem Physiotherapeuten dann möglich macht, eigene Techniken zu entwickeln und sich kreativ und fantasievoll dem Patienten zu widmen. Je mehr also ein Physiotherapeut die Unterschiedlichkeit der lebendigen Gewebe, ihre anatomischen und physiologischen Wechselbeziehungen, sowie die Diagnose- und Behandlungsprinzipien der Osteopathie verinnerlicht und ein Gefühl für sie entwickelt, desto effektiver, bewährter und schneller kann er die aufgetretenen Beschwerden lindern, heilen oder verschwinden lassen. Die Kraniosacrale Therapie wirft auch ein Licht auf die Schnittstelle, den Bereich des Zusammenwirkens von eingreifender und selbstregulierender Medizin. Also von herkömmlicher allopathisch-osteopathischer Medizin und psychophysiologischer Selbstregulation. Einfach ausgedrückt: Die Mechanismen zwischen Körper und Psyche werden beleuchtet. Das Kraniosacrale System und seine pathophysiologische Bedeutung wird von der Schulmedizin aber noch immer nicht anerkannt. Die Fortschritte und Erfolge sind eindeutig. Medizinisch belegbar ist dies nicht immer. So erklärt etwa ein Physiotherapeut das Gefühl, was er bei der V-Spreiz-Technik anwendet, als ein „Lenken der Energie“. Kritiker nennen dieses Gefühl abfällig eine „Projizierung“, die sich nur auf den Verstand des Therapeuten beschränkt. Doch aus der Sicht dieses Beobachters und desjenigen, der dieses Gefühl ebenfalls erlebt hat und vernünftige und plausible Erklärungen sucht, machen Physiotherapeuten, die auf dem vielschichtigen Gebiet der Zusammenhänge zwischen Körper und Seele tätig sind, erstaunliche Entdeckungen. Tatsachen, die das Konzept der Einheit von Medizin und Yoga, Körper und Seele, Bewusstem und Unbewusstem unterstützen. So kommt gerade in der Osteopathie der alte Konflikt - Schulmedizin gegen alternative Heilmethoden – wieder auf. Aber egal welcher Theorie man nun anhängt, bei unserem wichtigstem Gut, unserer Gesundheit, zählt letztendlich nur das Ergebnis. © Marcus Douale
Endlich: die WM ist angesagt
Für Sportgate Nun ist es also soweit: die deutsche Badminton-Mannschaft fliegt am .......... - als absoluter Höhepunkt – zur WM ins spanische Sevilla. Dabei wird der erste Teil der vierzehntägigen Veranstaltung von der Mannschafts-WM geprägt sein. Denn erst dann die folgen die Individual-Wettbewerbe. Der Start verspricht schon mal einiges: Deutschland ist in Gruppe 2. Es ist also machbar einen Platz zwischen Rang 7 bis Rang 16 zu erreichen. Aber eine endgültige Prognose zu geben, ist wegen der sehr ausgeglichenen Gruppen und Auslosungen sehr schwer. Es sieht so aus, dass Deutschland auf Malaysia, Japan und die Ukraine trifft. Der absolute Favorit heißt Malaysia, doch auch Japan könnte – neben Deutschland – auch Sieger dieser Gruppe werden. Vorausgesetzt alles läuft optimal. Doch es gibt auch Ungewisses: die Ukraine etwa wird zwar als Außenseiter gehandelt, doch sie könnte - durch ihre enorm starken Einzelspieler – für alle Teams zur absoluten Überraschung werden. Das Ziel der deutschen Mannschaft ist klar: es gilt in den Individual-Wettbewerben ein paar Achtel-Finalplätze und – wenn alles klappt – sogar ein oder zwei Viertel-Finalplätze zu schaffen. Doch es sieht gut aus: denn das Mixed-Duo Siegermund/Pitro hat sehr gute Chancen einen Platz zwischen 5 und 8 zu ergattern. Schon im Laufe der Saison lieferten diese beiden, von allen Deutschen, die besten Leistungen ab. Ein Setzplatz zwischen 9 und 16 war der verdiente Lohn dafür. Doch es könnten auch Probleme auftreten: etwa enorme körperliche und mentale Belastungen für Nicole Pitro. Denn sie soll alle Damen-Doppel und Mixed der Mannschaft spielen. Gute Plätze können sich auch Björn Joppien (im Herren-Einzel) und Nicole Greter/Nicole Pitro (im Damen-Doppel) ausrechnen. Schwierigkeiten stehen im Herren-Doppel an: Joachim Tesche ist aufgrund von Nachwirkungen seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel nicht 100% fit, und hat kaum Spielpraxis. © Marcus Douale
„Zehn Jahre braucht man bestimmt, um an die Spitze zu kommen“
Für Sportgate Wie geht man mit Erfolgen um? Wie mit Misserfolgen? Wie motiviert man sich? Und was gibt es über den Nachwuchs zu sagen? Ein Gespräch mit der erfolgreichen Olympiateilnehmerin Dr. Sabine Bau über die Vergangenheit und Zukunft des deutschen Fechtsports. Grundsätzlich: Was unterscheidet Fechten von anderen Sportarten? Komplexität. Einfach den verschiedensten Ansprüchen gerecht zu werden. Die Kombination von körperlicher Fitness, Beherrschung der Technik und enormen Kampfgeist. Vereinfacht gesagt, das Zusammenwirken von mentaler Stärke und all diesen Faktoren, macht Fechten so interessant. Ganz persönlich: Wie bereiten Sie sich auf Wettkämpfe vor? Gibt es so etwas wie ein Geheimrezept? Ich hab` da kein Geheimrezept. Für mich ist es wichtig, dass ich befreit `rangehe und keine größeren Belastungen habe. Vielleicht nur, dass ich rechtzeitig aufstehe, um eine halbe Stunde vor dem Wettkampf mit meinem Trainer nochmals Aufwärm-Lektionen durchzugehen. Was muss im deutschen Fechtsport verändert werden? Die Marketing-Strategien und Regeln müssen sich ändern und die Vermarktung des Fechtsports sollte verbessert werden. Man sollte die Jugend für`s Fechten begeistern und interessieren. Offene Arbeitsgemeinschaften (an Schulen) anbieten. Einfach die Kooperation Schule-Verein verbessern. Die Bilder und Gefühle der ersten Siege sind Ihnen sicher noch gut im Gedächtnis. Was hat sich für Sie seitdem verändert? Man setzt jetzt andere Prioritäten. Die ganz großen Katastrophen und Gefühlsschwankungen gibt`s nicht mehr. Man wird einfach abgeklärter. Ich gehe heute so ´ran, dass es für mich nicht mehr das Wichtigste ist im Leben. Sicherlich gab es auch in Ihrer Karriere Pechsträhnen, Formtiefs und Krisen. Haben Sie auch schon mal daran gedacht dem Fechtsport den Rücken zu kehren? Nein, wegen einer Krise nie. Ich hab` schon eher daran gedacht wegen der Arbeit mit dem Fechten aufzuhören. So leicht lasse ich mich nicht abschütteln. Für welche Sportarten interessieren Sie sich noch? Für`s Rudern, den Pferdesport, besonders Dressur- und Springreiten und Volleyball. Ich vermeide bewusst „Massenhysterie-Sportarten“, wie Fußball oder Tennis. Obwohl ich mich eigentlich auch für sie interessiere. Was haben Sie – neben Ihrem Sport und Beruf – noch für Interessen und Vorlieben? Ich reise sehr gern, lese viel (über die unterschiedlichsten Themen) und ich mag Tiere. Hab` selbst einen Hund und eine Katze. Aus Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung: Was müssen angehende Fechterinnen und Fechter unbedingt mitbringen? Das Wichtigste ist Spaß. Aber auch Durchhaltevermögen und Trainingsfleiß, und die körperlichen Voraussetzungen müssen stimmen. Denn zehn Jahre braucht man bestimmt, um an die Spitze zu kommen. Und was dürfen künftige Fechterinnen und Fechter auf keinen Fall mitbringen? Man darf keine Angst vor dem Gegner und der Waffe haben. Und man sollte ein kein „Ja-Sager“ sein... Woraus schöpfen Sie Kraft? Wie motivieren Sie sich? Weil`s funktioniert macht`s Spaß. Ich motiviere mich weniger damit nochmals zu einer WM oder EM zu fahren, sondern weil mir ganz einfach das Fechten Freude bereitet. Solange es mir Spaß macht, bleibe ich dabei. Vielen Dank für das Interview, und alles Gute für die Zukunft. © Marcus Douale Alle Artikel öffnen / schliessen |
|
|
|
|